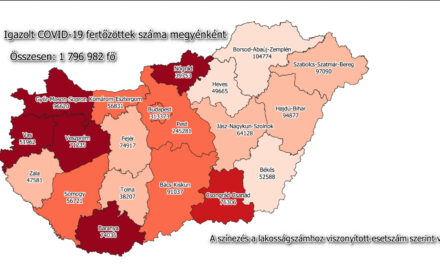In den letzten Tagen sind aktuelle Daten von Eurostat ans Licht gekommen, denen zufolge der Verbrauch der ungarischen Haushalte 70 Prozent des EU-Durchschnitts erreicht. Mehrere Personen hätten die Daten falsch interpretiert und die öffentliche Meinung absichtlich in die Irre geführt, indem sie behaupteten, Ungarn sei das ärmste Land in der EU, was völliger Unsinn und eine bewusste Lüge sei, teilte das Ministerium für Volkswirtschaft (NGM) mit.
„Wirtschaftliche Einfachheit“ beruhe der Ankündigung zufolge darauf, dass Familien ihr Einkommen aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen konsumieren oder sparen. Dieser Weg
Die Verbrauchsdaten allein sind nur bedingt interpretierbar, daraus einen Rückschluss auf Armut zu ziehen, ist ein böswilliger Ausrutscher.
Die Tatsachen hingegen zeigen, dass durch den Krieg nebenan das Vorsichtsmotiv der ungarischen Familien auf ganz natürliche Weise gestärkt wurde. Damit stieg die Bruttosparquote der Bevölkerung gegenüber dem zuvor hohen Niveau noch weiter und überschritt mit 21 Prozent den höchsten Wert innerhalb der Union. Folglich
Ungarische Familien geben ihr Einkommen nicht aus, sondern sparen es.
Dies wird durch die Tatsache gestützt, dass das Bruttofinanzvermögen ungarischer Familien im Vergleich zu Anfang 2022 um mehr als 22,5 Milliarden Forint gestiegen ist (im Vergleich zu Anfang 2010 um 72 Milliarden Forint), sodass es bereits über 102.000 liegt Milliarden Forint, schrieben sie.
Im internationalen Vergleich lässt sich feststellen, dass das Nettovermögen ungarischer Familien 106 Prozent des BIP übersteigt und damit im Mittelfeld der EU liegt. In dieser Hinsicht liegt unser Land vor Ländern in der Region wie der Slowakei, Rumänien oder Polen. Aufgrund der hohen Sparneigung
Im Jahr 2023 war das Zinseinkommen der ungarischen Haushalte im Verhältnis zum BIP das höchste in der Europäischen Union, der ungarische Wert von 4 Prozent lag mehr als doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt von 1,9 Prozent.
Dies ist vor allem auf die erfolgreiche Selbstfinanzierung zurückzuführen, da der Bestand an Staatspapieren im Besitz privater Haushalte im Verhältnis zur Bruttostaatsverschuldung seit Jahren der höchste in Ungarn ist und Ende 2023 bei 21,9 Prozent der ungarischen Bruttostaatsverschuldung lag Die Schulden befanden sich im Besitz privater Haushalte in Form von Staatspapieren. Grundlage der Einsparungen ist das stetig steigende Lohnniveau und die zunehmende Beschäftigung. Im Vergleich zu 2010 gibt es eine Million mehr Menschen, die arbeiten, während die Arbeitslosigkeit eine der niedrigsten in der EU ist.
Darüber hinaus erhalten ungarische Familien immer höhere Einkommen, der Bruttodurchschnittslohn liegt bei knapp 660.000 HUF, was bereits mehr als dreimal so viel ist wie zu Zeiten des Dollars. Die Regierung erreichte eine noch stärkere Erhöhung des Mindestlohns und des garantierten Mindestlohns, die im Vergleich zu 2010 bereits um mehr als das 3,6-fache gestiegen sind.
Diese Wachstumsrate gehört zu den höchsten in der EU.
Mit anderen Worten: In Ungarn verdienen immer mehr Menschen mehr und die Gehälter werden immer höher. Im letzten Jahrzehnt sind die Reallöhne kontinuierlich gestiegen, ein Anstieg, der durch den Krieg nur vorübergehend gestoppt wurde, da die Regierung die Inflation unterdrückte, so dass ab September der übliche Anstieg der Kaufkraft der Gehälter in den Vorjahren wieder einsetzt.
In Ungarn ist die Armut infolge steigender Löhne und zunehmender Beschäftigung letztlich deutlich zurückgegangen, da laut EU-Methodik die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen im Vergleich zu 2010 um mehr als 1,2 bis 1,3 Millionen zurückgegangen ist
Die Armutsquote sank deutlich unter den EU-Durchschnitt, was ein epochales Ergebnis darstellt.
Darüber hinaus ist es erfreulich, dass das Einzelhandelsvolumen im vierten Monat im Jahresvergleich kontinuierlich zunimmt, die Familien also immer mehr konsumieren, sodass sich das Motiv der Vorsicht zunehmend auflöst. All dies trage dazu bei, das Tempo des Wirtschaftswachstums zu erhöhen, heißt es in der Ankündigung.
MTI
Titelbild: Foto: Zsolt Szigetváry | Quelle: MTI/MTVA